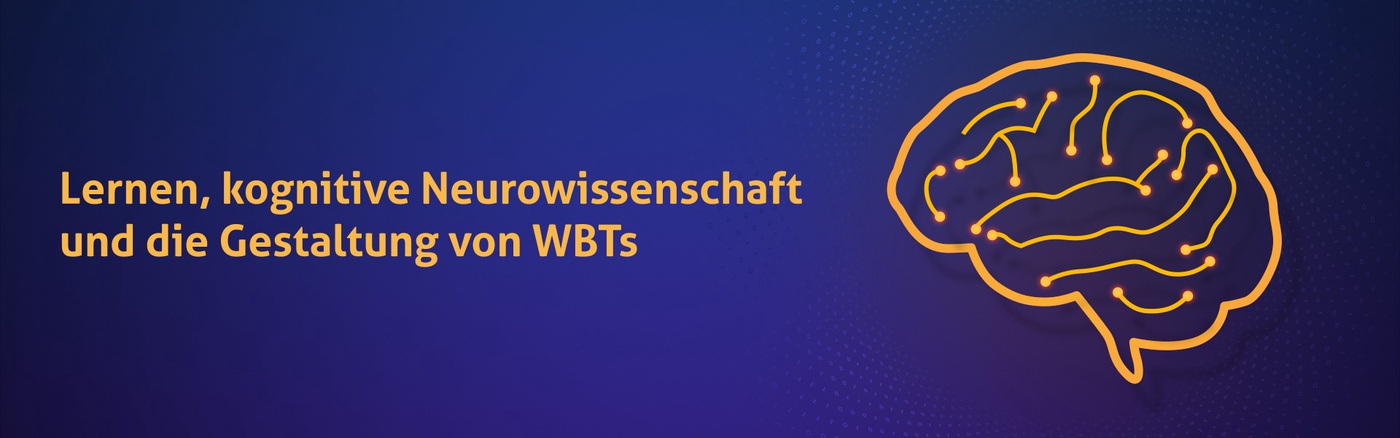Lernen, kognitive Neurowissenschaft und die Gestaltung von WBTs
Skript für ein Audio-Podcast, von Nils van Well, 08.02.2021
Dauer: 15 Min.
Dauer: 1. Einleitung
w: Was passiert in unseren Köpfen, wenn wir lernen?
w: In den letzten 20 Jahren haben Neurowissenschaftler die Frage neu gestellt, wie unser Gehirn lernt. Der Hirnforscher Stanislas Dehaene fasst wichtige Erkenntnisse in einem neuen Buch zusammen und verbindet sie mit Aussagen der kognitiven Psychologie, die sich mit Denken und Wahrnehmen befasst. Seine Thesen sind anregend, auch für die Gestaltung von Web Based Trainings.
m: Haben Sie sich schon mal über ein WBT geärgert? Vielleicht sogar öfter? Weil ein ohnehin trockenes Thema auch noch spröde dargeboten wurde? Ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, Interesse zu wecken? WBTs sind DIE Lernmedien im Unternehmensumfeld.
w: Und die oftmals schlichte Darbietung der Informationen in WBTs lässt darauf schließen, wie sich die Autoren der WBTs die Informationsverarbeitung vorstellen: wie einen Kopiervorgang. Das Gehirn als Festplatte mit verschiedenen Partitionen. Schon vor Jahren stellte die Pädagogin Käthe Meyer-Drawe die These auf, dass das Aufkommen künstlicher Intelligenz dazu führe, dass Menschen sich selbst als maschinenhaft wahrnehmen.
m: Wie funktioniert künstliche Intelligenz? Was kann sie?
w: Diese Fragen stellt Stanislas Dehaene an den Anfang seines Buches und fragt anschließend, was das menschliche Gehirn von der Maschine unterscheidet. Der Titel des Buches: „How We Learn. Why Brains Learn Better Than Any Machine … for Now“.
w: Dehaene ist Franzose, ursprünglich Mathematiker, und hat viele Jahre geforscht, welches Verständnis von Zahlen Neugeborene und Kleinkinder haben und wie sie Sprache lernen. Auch mit bildgebenden Verfahren hat er Vorgänge im Gehirn untersucht, zusammen mit seiner Frau Ghislaine Dehaene-Lambertz. Diese Forschungsergebnisse greift das Buch auf.
w: 2. Künstliche Intelligenz
w: Was ist Lernen, fragt Dehaene zunächst.
m: Lernen ist, ein internes Modell der externen Welt zu erzeugen.
w: Und wie gehen künstliche neuronale Netze vor, wenn sie solche Modelle erzeugen?
m: Dehaene beschreibt sieben Prinzipien, welche solche modernen Rechnersysteme anwenden. Es sind Algorithmen, Handlungsvorschriften zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen.
w: Ein Prinzip ist beispielsweise, dass zwei Systeme als Akteur und Kritiker gegeneinander antreten. Der Akteur nutzt die Evaluierung des Kritikers, um seine Vorgehensweise zu korrigieren. Reinforcement Learning heißt diese Methode. Google nutzt sie, um den Energieverbrauch seiner Serverlandschaften zu reduzieren. Das Computerprogramm AlphaGo verwendete Reinforcement Learning, um das asiatische Brettspiel Go zu spielen und gegen einen der weltbesten Profi-Spieler zu gewinnen.
m: Manche Leistung der künstlichen neuronalen Netze wirkt zunächst beeindruckend. Doch im Vergleich zum menschlichen Gehirn betont Dehaene entscheidende Einschränkungen künstlicher Intelligenz der Gegenwart:
w: Die meisten sogenannten deep learning Algorithmen berechnen lediglich Vorgänge, die der Mensch als sensorische Reize unbewusst und automatisch verarbeitet.
w: 3. Menschliches Lernen
m: Charakteristisch für das menschliche Lernen, sei die unablässige Suche nach abstrakten Regeln, Schlussfolgerungen auf hohen Ebenen, die Frau und Mann aus Beobachtungen ableiten und anschließend in anderen Situationen überprüfen. Künstliche Intelligenz sucht bis dato lediglich nach Mustern. Menschen erkennen nicht nur Muster, sondern nutzen sie für Vorhersagen.
w: Bereits Neugeborene und Kleinkinder erlernen die Bedeutung von Worten, in dem sie eine Hierarchie von Hypothesen anwenden. Das menschliche Gehirn priorisiere Informationen sehr schnell und sei ständig auf der Suche nach abstrakten Konzepten, nach einer generellen Logik, die es übertragen kann. Der biologische Sinn hinter dieser Flexibilität ist, dass sich der Mensch sehr schnell an unvorhersehbare Umstände anpassen kann.
m: Was unterscheidet Mensch und Maschine noch?
w: Künstliche neuronale Netze benötigen große Datenmengen, um eine Information herauszufiltern. Babys hingegen lernen ein neues Wort in einer bestimmten Entwicklungsphase mit ein oder zwei Wiederholungen. Woran liegt das?
m: Für Dehaene entwickelt sich unser Gehirn mit zwei Eigenschaften. Erstens, wachsen alle wichtigen Verbindungen im Gehirn in festgelegten Bahnen.
w: Umgangssprachlich könnte man sagen, das Gehirn ist vorverdrahtet.
m: Zweitens, besitzen bereits Neugeborene ein Vorstellung, was ein Objekt ausmacht, dass es der Schwerkraft unterliegt und kein Lebewesen ist. Neugeborene haben einen Sinn für Zahlen, eine Vorliebe für Sprache und für Gesichter; und sie wissen, dass Menschen Intentionen verfolgen.
w: Tierversuche haben gezeigt, dass bestimmte Tierarten ebenfalls über angeborenes Vorwissen verfügen, zum Beispiel über Mengen, also ebenfalls einen Zahlensinn besitzen. Gehirne haben eine lange Entwicklungsgeschichte.
m: Für Dehaene ist das Gehirn Neugeborener keine leere Festplatte, sondern entwickelt sich nach einen hochdifferenzierten Bauplan, verfügt über angeborenes Vorwissen und ist mit einer Arbeitssprache ausgestattet. Deshalb lernt es so schnell und lernt, in dem es Vorhersagen bildet und überprüft. Lernen bedeutet, dass das Gehirn Schemata bildet und testet. Lernen ist aktiv und kein passiver Kopiervorgang.
w: Wenn das Gehirn auf diese Weise lernt, wie lässt sich Lernen fördern?
m: Dehaene nennt vier Tragpfeiler, die für das Lernen entscheidend sind:
m: Aufmerksamkeit, aktives Engagement, Feedback und Konsolidierung. Keiner dieser Punkte ist neu, aber Dehaene unterfüttert sie mit den Erkenntnissen der Neurowissenschaft und gibt ihnen damit neues Gewicht.
m: 4. Aufmerksamkeit
w: Aufmerksamkeit.
w: Information muss durch Aufmerksamkeit und Bewusstheit verstärkt werden, um gespeichert zu werden. Lehrer und Lernmedien sollten Aufmerksamkeit stützen und darauf achten, was sie einschränkt und begrenzt. So weit bekannt.
m: Einzigartig am Menschen sei, dass Aufmerksamkeit und Lernen von sozialen Signalen abhängig ist, so Dehaene. „Ich beachte, was Du beachtest; und ich lerne, was Du mir beibringst“, heißt dies vereinfacht. Jede Art von Lehre, auch am Computer, die lediglich mechanisch Lektionen austeilt, ohne Aufmerksamkeit und Erwartungen zu beachten, ist ineffizient.
w: Auch dies ist nicht neu. Aber Dehaene beschreibt in großer Klarheit, wie sehr wir für die Steuerung unserer Aufmerksamkeit soziale Hinweise benötigen.
m: Schon lange wird für die Gestaltung von Lernmedien empfohlen, sie mit einer persönlichen Ansprache einzuleiten. Dehaene liefert hierfür eine erneute Begründung.
w: Interessant ist an dieser Stelle der Vergleich mit künstlichen neuronalen Netzen. Denn moderne Rechnersysteme können die Muster, die Schemata, die sie erkennen, nicht exportieren, nicht weitergeben. Bisher jedenfalls. Menschen jedoch lernen grundsätzlich von anderen, sie teilen ihr Wissen.
w: 5. Aktives Engagement
m: Zweiter Tragpfeiler des Lernens: Aktives Engagement.
m: Ohne vertiefte Verarbeitung, kein Lernen.
m: Für aktives Engagement gibt es kein Patentrezept. Aber alles, was Lernende veranlasst, die Komfortzone der Passivität zu verlassen, kann sinnvoll sein. Neugierde ist ein dabei ein Schlüsselelement. All dies ist Common Sense.
w: Aber Dehaene betont selten deutlich: Gerade weil aktives Engagement eine Motivation erfordert, hat Wissbegier und ihre motivierende Kraft eine zentrale Bedeutung.
m: Und, – Neugierde ist ein Urmotiv von Organismen. Denn in einer unsicheren Welt kann Erkunden das Überleben sichern. Folglich belohnt das Dopamin-System dieses Verhalten und neue Informationen. Auch beim Menschen.
w: Besonders wichtig: Neugier lenkt unsere Motivation auf neue Informationen, denen wir gewachsen sind, die also nicht zu einfach und deshalb langweilig und andererseits nicht zu komplex sind. Nebenbei führt Neugierde unmittelbar zu einer besseren Gedächtnisleistung.
m: Dehaene beschreibt ausführlich, wie der Schulbetrieb Neugierde abtöten kann. Unterschwellig zum Beispiel, in dem ein Lehrer sehr ausführlich in ein Thema einführt oder etwas umfassend erläutert und so den Eindruck hinterlässt, dass er bereits alles erklärt habe, was wissenswert ist, anstatt klar zu machen, dass es noch tausend Dinge zu entdecken gibt. In der Folge schalten Schüler in einen rezeptiven Modus. Engagement wird deaktiviert.
w: Mit dem Fokus auf die Motivationssteuerung fragt die kognitive Neurowissenschaft konsequent, wie das Belohnungssystem aktiviert und Neugierde geweckt werden kann, wenn Lernen das Ziel ist. Und die Frage, wie man Interesse für ein Thema wachruft, gilt folglich auch für die Gestaltung von WBTs.
m: Die kognitive Psychologie hingegen diskutieren seit Jahrzehnten die Frage, wann Belohnungen eine negative Rolle spielen. Suzanne Hidi, die an der Universität Toronto über Interesse und Motivation forscht, resümierte 2016 in einem Aufsatz für die Zeitschrift Educational Psychology Review, dass ihre Disziplin die positiven Aspekten des Belohnungssystems auf die Agenda setzen müsse, im Interesse der Menschen, denen Motivation fehlt.
m: 6. Feedback
w: Dritter Tragpfeiler des Lernens: Feedback.
w: Weil das menschliche Gehirn mit Wahrscheinlichkeiten und Vorhersagen arbeite und Hypothesen bilde, benötige es informative und zeitnahe Rückmeldungen, so Dehaene. Präzises Feedback reduziere die Unsicherheit des Lernenden in Bezug auf seine Hypothesen.
m: Benotungen hingegen enthielten keine inhaltliche Information, sondern stigmatisieren und bestrafen regelmäßig.
w: Die Lernforschung betont die Bedeutung einer bestimmten Art von Feedback seit langem. Dehaene formuliert eine weitere Begründung, warum informatives Feedback ohne Bestrafung so wichtig ist.
m: Was heißt dies für die Lernzielkontrollen in WBTs?
w: Man könnte sagen: Lernzielkontrollen sollten Vermutungen, Schlussfolgerungen und möglichen Hypothesen nachgehen, die sich aus den Inhalten es WBTs ableiten lassen.
w: 7. Konsolidierung
m: Vierter Tragpfeiler des Lernens: Konsolidierung.
m: Jede Nacht verarbeitet unser Gehirn die Information des vorangegangenen Tages. Dies hat die Schlafforschung in den letzten 30 Jahren nachgewiesen.
w: Noch sind viele Details unklar. Fest steh jedoch, dass der Hippocampus und andere Hirnregionen nachts tatsächlich Informationen verlagern und verallgemeinern. Dehaene schließt sich deshalb einer Forderung etwas der American Academy of Pediatrics an, der Kinderheilkunde, die fordert, dass der Unterricht von Teenagern später beginnen muss, um ihrem Schlafrhythmus zu folgen.
m: Um Informationen nachhaltig im Gedächtnis zu verankern, ist eine andere Erkenntnis interessant, auf die Dehaene hinweist. Auch für die Gestaltung von WBTs.
w: Wer Informationen langfristig behalten will, sollte sie über einen gestreckten Zeitraum hinweg wiederholen. Eine zeitnahe Wiederholung ist im Vergleich uneffektiv.
w: 8. Resümee
m: Gibt es ein Resümee?
w: Ja, Dehaene stellt als Neurowissenschaftler alte Fragen neu und verleiht alten Erkenntnissen neuen Nachdruck. Bereits in den 70er Jahren führten die Psychologen Inghard Langer, Friedemann Schulz von Thun und Reinhard Tausch an der Universität Hamburg Versuche durch, um herauszufinden, wie Schulbücher verständlicher getextet werden können.
m: Sie entwickelten das Hamburger Verständlichkeitskonzept. Ihr Buchtitel „Sich verständlich ausdrücken“ ist ein Longseller, verkauft sich aktuell in der 11. Auflage und nennt zunächst vier Merkmale der Verständlichkeit:
w: Einfachheit, Gliederung bzw. Ordnung, Kürze bzw. Prägnanz sowie zusätzliche Anregungen, womit beispielsweise direkte Rede oder rhetorische Fragen gemeint sind. Belebende Elemente machen einen Text also verständlicher.
m: Besonders aufschlussreich ist die Empfehlung am Ende des Buches: Wer nicht nur verständlich sein und Informationen zur Kenntnis geben möchte, sollte personenzentriert schreiben. Informationen vermitteln sich umfassender und Texte gelten als interessanter und mitunter verständlicher, wenn sich ein Autor in die Leser einfühlt, Rücksicht auf sie nimmt oder versucht in eine Beziehung einzutreten.
w: Frei nach Dehaene könnte man sagen: Menschen lernen gerne von anderen Menschen, wenn sie wie Menschen angesprochen werden.
m: Dies war ein Audio-Podcast von Nils van Well.
w: Gesprochen von: Arlett Drexler
m: und Armin Berger.